Wirtschaftsinformatik (Bachelor-Studiengang): Rechnernetze/Onlinedienste (2. Semester)
Sie sind hier: Startseite › Wirtschaftsinformatik › Rechnernetze/Onlinedienste: Kabelsysteme
BM / CM, Kurs vom 01.10.2002 - 31.03.2003
- Einführung
- Kupferkabel
- Glasfaserkabel
- Repeater, Bridge, Router, Switch, Gateway
- Strukturierte Verkabelung
Einführung
Probleme bei LAN
- Sanierungsfälle alter Ethernets/Cheapernets (z.B. Korrosion billiger Anschlüsse)
- Hohe Kosten durch aufwendige Fehlersuche
- Hohe Kosten durch Baumaßnahmen
- LAN-Typ-abhängige Verkabelung
- Mindestens 90 % der Netzstillstandzeiten beruhen auf Verkabelungsproblemen
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) problematisch
Daher:
- Trennung von Kabelsystemen von LAN-Techniken
- Strukturierte Verkabelung: LAN-Verkabelung und Telefon-Verkabelung
Arten von Komponenten
Passive Komponenten:
- Kabel
- Stecker/Buchsen
- Verbindungen, Verteiler
Aktive Komponenten:
- Verstärker (Repeater)
- Brücke (Bridge)
- Router
- Switch
- Hub
- Gateway
Aufteilung der Medien
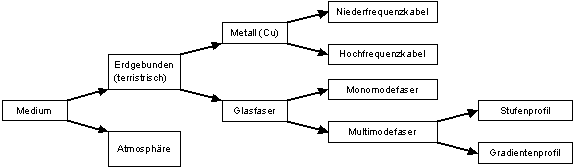
Bildbeschreibung "Aufteilung der Medien": Zwei Arten. Erdgebunden (terristrisch) und Atmosphäre. Die terristrischen Medien werden weiter unterteilt in Metall und Glasfaser. Im Metall-Bereich wird verwiesen auf Niederfrequenzkabel und Hochfrequenzkabel. Im Glasfaser-Bereich erfolgt eine weitere Unterteilung in Monomodefaser und Multimodefaser. Letzeres kann noch in Stufenprofil und Gradientenprofil unterschieden werden.
Kupferkabel
Niederfrequenzkabel (Cu): Twisted Pair (TP)
- Sternvierer:
4 verdrillte Adern, Telefonnetz - Unshielded Twisted
Pair (UTP):
Paare verdrillter Adern mit höherer Qualität als Sternvierer - Shielded Twisted
Pair (STP):
wie UTP, pro Paar abgeschirmt - S-UTP:
UTP mit Gesamtschirm, (S wie Screen) - S-STP:
STP mit Gesamtschirm
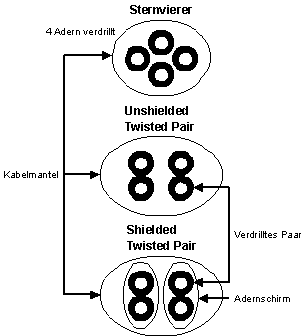
Bildbeschreibung "Niederfrequenzkabel (Cu)": Darstellung der drei Kabelsorten TP, UTP und STP.
Bauformen:
Die obigen Darstellungen zeigen das Prinzip.
Es sind mehr als die gezeichneten Adernpaare möglich:
So benötigen viele Netze 4 Paare (8 Adern), so dass dafür
z.B. ein UTP-Kabel
nicht zwei
sondern vier Adernpaare haben muss.
Es gibt verwirrend viele Kabelarten, die teilweise Mischungen aus den obigen "Reinformen" sind.
Um Vergleichbarkeit sowie Kompatibilität herstellen, wurden Typen bzw. Kategorien definiert.
Begriffserklärungen:
Ein Verbindungskabel ist ein Kabel zwischen einem Anschluss/Dose und dem Endgerät.
Ein Patchkabel ist ein relativ kurzes Kabel zur Verbindung zweier Kabelenden in Verteilerräumen; die Kabelenden werden in Rangierfeldern (patch panel) mit Dosen versehen, in die zur Verbindung die Patchkabel eingesteckt werden.
In der Praxis werden Patchkabel häufig als Verbindungskabel eingesetzt.
Steckertypen
- Hermaphrodit (IBM Verkabelungssystem)
Stecker und Buchse, voll abgeschirmt, viel Platz nötig - RJ-45 (Western Plug)
weit verbreitet (Telefon)
Platz für 4x RJ-45 etwa 1x Hermaphrodit
bis 3 MHz konzipiert - TAE6-Stecker
(TAE
= Telekommunikations-Anschluss-Einheit)
TAE6-F: Telefon, TAE6-N: Modem, Fax oder Anrufbeantworter
Die 6 weist auf 6 Anschlüsse hin.
Hochfrequenzkabel:
Aus der Hochfrequenz-/Antennentechnik
- Koaxialleitung
Innenleiter und Außenleiter, Zwischenraum ist Luft oder festes Isolationsmaterial - Koaxialkabel
Innenleiter und Außenleiter, Zwischenraum ist mit Isolationsmasse ausgefüllt
Unterstützt Bandbreiten bis zu 400 MHz.
Arten:
- 50 Ohm-Koaxialkabel
- 75 Ohm-Koaxialkabel (Breitbandnetze)
- 92 Ohm-RG 62-Koaxialkabel für IBM 3270-Terminals
Praktische Relevanz:
- "Standard"-Ethernet-Kabel (Koaxialkabel)
Meist in gelb mit roten Kennungen alle 2,5 m (Yellow Cable, Thick Wire)
Impedanz 50 Ohm
Relativ schwer
min. Biegeradius 20..25 cm - "Cheapernet"-Kabel (Koaxialkabel)
RG 58 (Thin Wire)
max. Segmentlänge 185 m mit max. 30 Anschlüssen
Impedanz 50 Ohm
min. Biegeradius 8 cm
Konnektoren (Anschlüsse)
Standard-N-Konnektor:
- Koaxialkupplung mit Schraubverschluss
- Kabel wird eingeklemmt oder gelötet
- Für Cheapernet: T-BNC-Anschluss
- BNC: Bayonet Neill Councelman
Vampir-Tap:
Kabel wird zwischen zwei Blöcken fixiert und im 90° Winkel mit einer "Nadel" angebohrt, Nachteil: Korrosion.
Glasfaser
Lichtwellenleiter (LWL), Glasfaser, Fiber
Vorteile:
- Leichte Verlegbarkeit
- Hohe Kapazität
- Abstrahlsicherheit (Abhörsicherheit)
- Einstrahlsicherheit (Störsicherheit)
Nachteile:
- Höhere Anschlusskosten
- Hoher Konfektionierungsaufwand
- Teure Gerätetechnik
Prinzipieller Aufbau einer Verbindung:
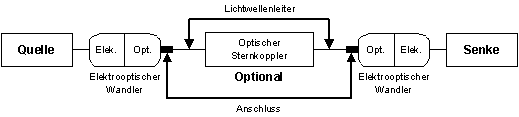
Bildbeschreibung "Prinzipieller Aufbau einer Verbindung": Quelle, elektrooptischer Wandler, Anschluss, Lichtwellenleiter, optischer Sternkoppler (optional), Lichtwellenleiter, Anschluss, elektrooptischer Wandler, Senke.
Grundprinzip
Reflektion aufgrund unterschiedlicher Brechungsindices zwischen Kern und Mantel.
Mode: einzelner "Lichtstahl" durch den Kern
(geometrisch zulässiger Weg durch das Medium)
Multimode: gleichzeitig mehrere Mode möglich
Monomode: Nur eine Mode möglich
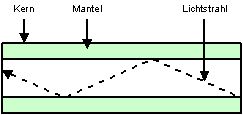
Bildbeschreibung "Grundprinzip von Glasfaser": Jeder Lichtstrahl, der (innen) auf den Mantel trifft, wird vom Mantel reflektiert und dadurch weitergeleitet.
Reflektionen im LWL:
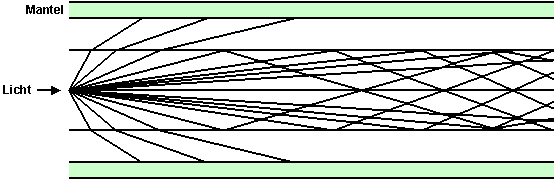
Bildbeschreibung "Reflektionen im LWL": Teile des Lichtes gehen durch Nicht-Reflektion verloren.
Nur ein Teil des Lichts kommt beim Empfänger an. Das Licht strahlt trotz Biegung des LWL immer noch in gerader Richtung.
Faserarten
| Faserarten | Indexprofil | Profil des Brechungsindex | Wellenausbreitung |
|---|---|---|---|
| Stufenprofilfaser: Bitratenprodukt: 5 MHz km Länge: 1 km ca. 1970 |
Stufenindexprofil |  |
 Reflektionen Multimode |
| Gradientenprofilfaser: Bitratenprodukt: 1,5 GHz km Länge: 10 km ca. 1980 |
Gradientenindexprofil |  |
 Reflektionen Multimode |
| Monomodefaser: Bitratenprodukt: 250 GHz km Länge: 50 km ca. 1990 |
Stufenindexprofil |  |
 Monomode |
Daten über Metallleiter und Glasfaser:
- Lichtgeschwindigkeit im Vakuum (c0) ca. 300.000 km/s
- Signalgeschwindigkeit
in Metall: 60-80% von c0
in Glasfaser: 60-70% von c0 in Abhängigkeit
Dichte/Brechungsindex - Wellenwiderstand (Impedanz) Beispiel
Koax: 50 Ohm (Ethernet)
TP: 100 Ohm (Ethernet)
Kopplungen von Kabeln mit unterschiedlichen Impedanzen führen zu nicht erwünschten Reflexionen
- EIA: Electronic Industries Alliance
- TIA: Telecommunications Industry Association
- IEC: International Electrotechnical Commission
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
EIA/TIA 568 Commercial Building Cabling Std.
Vollständiger Name: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
- Einteilung der Kabel in 5 bzw. 7 Kategorien
- Empfehlung:
Zu jedem Arbeitsplatz: 2 Cu-basierte Wege
Jedes weitere LWL-Kabel wird als Ergänzung angesehen - Entfernung zwischen Endgerät und Verteilerraum wird als max. 100 m angenommen
EIA/TIA 568 Kabelkategorien:
- Kategorie 1:
Billigkabel, analoge Sprachübertragung, bis 1 Mbit/s
Entspricht Telefon-Sternvierer
Für Neuinstallationen nicht zu empfehlen - Kategorie 2:
Ersatz für Kategorie 1, bis 4 Mbit/s über mittlere Entfernungen, ISDN, kleine Token Ring-Netze - Kategorie 3:
UTP/STP bis 10 Mbit/s, schließt Kategorie 1 und 2 ein,
Z.B. Ethernet 10BaseT bis 100 m - Kategorie 4:
UTP/STP bis 20 Mbit/s über größere Entfernungen als mit Kategorie 3 - Kategorie 5 und 5e (Erweiterung):
Mehr als 20 Mbit/s bis 100 Mbit/s bis 100 m
z.B. Fast Ethernet oder FDDI - Kategorie 6 (Erweiterung):
bis 200 Mbit/s, mit Hilfsmittel bis 400 Mbit/s - Kategorie 7 (Erweiterung):
bis 600 Mbit/s
Zusammenhang Kabeltyp und LAN-Typ
| Kabeltyp | 4 Mbit/s Token Ring |
10 Mbit/s Ethernet |
16 Mbit/s Token Ring |
100 Mbit/s FDDI |
|---|---|---|---|---|
| Koax | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Glasfaser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UTP 3 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| UTP 4 | Ja | Ja | Ja | Nein |
| UTP 5 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Terminatoren:
Offene Enden reflektieren die Signale. Dies verhindert ein Widerstand zwischen den Leitungen (Terminator).
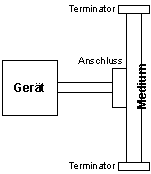
Bildbeschreibung "Terminatoren": An die Enden der Leitung werden sogenannte Terminatoren geklemmt, die einen Widerstand darstellen und somit das Reflektieren von Signalen verhindern.
| Kabel | Typische Bandbreite | Reichweite |
|---|---|---|
| TP 5 | 10 bis 100 Mbit/s | 100 m |
| Dünnes Koaxialkabel | 10 bis 100 Mbit/s | 200 m |
| Dickes Koaxialkabel | 10 bis 100 Mbit/s | 500 m |
| Multimode-Faser | 100 Mbit/s | 2 km |
| Monomode-Faser | 100 bis 2400 Mbit/s | 40 km |
Repeater, Bridge, Router, Switch, Gateway
Repeater
- Verstärker auf der OSI-Ebene 1
- Protokolltransparent für Ebenen 2 und höher
- Überbrückung größerer Entfernungen
Multiport-Repeater werden Hub genannt.
Port = Anschluss
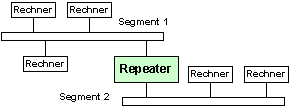
Bildbeschreibung "Repeater": Mehrere Rechner sind in zwei Segmente unterteilt. Diese zwei Segmente werden durch den Repeater, der als Verstärker dient, miteinander verbunden.
Hubs sind heute häufig komplexe bis zur Ebene 3 gehende Verteilsysteme (siehe Switch).
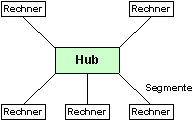
Bildbeschreibung "Hubs": Ein Hub dient als Verteiler. Er verbindet mehrere Rechner oder auch Rechnersegmente sternförmig.
OSI-Einbindung der Repeater:
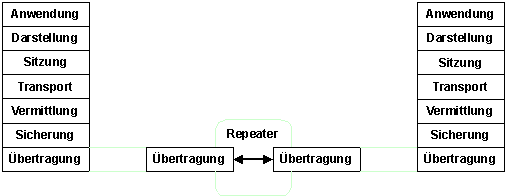
Bildbeschreibung "OSI-Einbindung der Repeater": Repeater (Verstärker) arbeiten auf unterster OSI-Ebene, der Übertragungsebene.
Hub:
- Hub ist ein Verteiler (Verteilkasten)
- Konzentrationspunkt: Wiring Hub
- Hub können untereinander verbunden werden
- Hub können hierarchisch verbunden werden
- Kategorien:
- Unternehmensweite Hub (enterprise) werden untereinander mit einem Backbone verbunden
- Abteilungsweite Hub (department)
- Arbeitsgruppenweite Hub (workgroup)
- Leistungsfähigkeit wird primär durch die internen Busse bestimmt
Wenn zwei Computer über ein TP-Kabel verbunden werden sollen, ist ein Crossover-Kabel oder die Benutzung eines Hub erforderlich.
Um zwei Hub zusammenzuschalten, müssen beide über die Uplink-Buchse des einen mit einem Patchkabel verbunden werden. Da diese kurz sind, werden die Hub aufeinander gestellt (gestapelt).
Arten von Applikationen/Rechnern
Server:
Anwendung oder spezieller Rechner, der Dienstleistungen ( Services) für andere Rechner (auch andere Server) anbietet
- Form einer Zentralisierung von Funktion
- Auch mit mehrfachen Redundanzen um Ausfallsicherheit zu erhalten
- Manchmal spezielle Betriebssysteme
Client:
Anwendung oder spezieller Rechner (typisch PC oder Terminal), der von Server Dienstleistungen abruft.
- Desktop-Betriebsysteme
Bridge
- Lasttrennung zwischen Segmenten ermöglicht Parallelität
- Protokolltransparenz auf Ebene 2
- Trennung der logischen Adressräume
- Weiterleitung in ein anderes Segment nur, wenn eine Station aus einem anderen Segment adressiert wird
Zur Performance-Steigerung sollten Server und Clients nach dem Lokalitätsprinzip auf die Segmente verteilt werden:
"Was häufig miteinander kommuniziert, gehört in dasselbe Segment."
OSI-Einbindung einer Brücke:
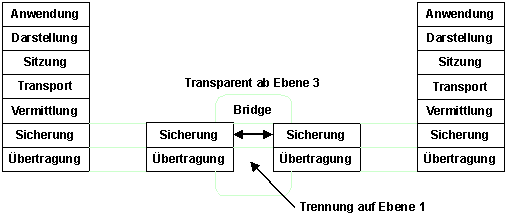
Bildbeschreibung "OSI-Einbindung einer Brücke": Eine Bridge (Brücke) verbindet Rechner und Rechnersegmente auf OSI-Ebene 2, der Sicherungsebene.
Lernende Brücke:
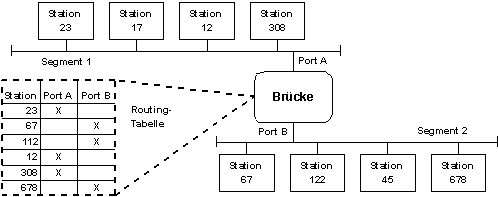
Bildbeschreibung "Lernende Brücke": Die Lernende Brücke enthält eine sogenannte Routing-Tabelle, in der sie speichert, aus welchem Segment der jeweilige Rechner zugreift. Sind alle möglichen Quell-/Zieladressen bekannt, kann die Brücke die Weiterleitung von Paketen, die in ein und demselben Segment liegen verweigern. Dadurch wird unnötige Netzlast vermieden. Andersrum weiß die Brücke dann auch, dass Pakete, die an das jeweils andere Segment adressiert sind, weitergeleitet werden müssen.
Lernverfahren:
Initialisierung: Routing-Tabelle löschen.
Alle Datenpakete an allen Ports (Schnittstellen der Brücke) ansehen und vermerken, an welchem Port welche Quell-Adressen beim Senden benutzt werden.
Routing-Tabelle enthält von allen Stationen, die einmal gesendet haben, den Port, über den sie erreichbar sind.
Erreicht ein Paket die Bridge, dessen Ziel-Adresse in der Tabelle enthalten ist, wird das Paket an den Port weitergeleitet, der zur Zielstation führt bzw. nicht weiter geleitet.
Wenn die Zieladresse nicht in der Tabelle enthalten ist, wird das Paket immer weitergeleitet.
Dies lässt sich auch für Multiport-Bridge
verallgemeinern:
Ist die Zieladresse unbekannt, wird das Paket über alle
anderen Ports gesendet.
Ist sie bekannt, nur über das Port, der mit der Zielstation
verbunden ist.
Zum Start arbeitet die Bridge wie ein Repeater, später immer mehr wie eine die Segmente trennende Brücke.
Das Verfahren kommt in Probleme, wenn dieselben Adressen in verschiedenen Segmenten verwendet werden, weil z.B. Stationen im Betrieb die Segmente wechseln.
Alterung/Vergessen:
- Jeder neue Eintrag bekommt einen Zeitstempel.
- Bei jedem Lernen wird der Zeitstempel aktualisiert.
- Einträge, die älter als eine bestimmte Zeitspanne sind, werden gelöscht.
Switch (Layer-2-Switch)
- Ein Switch ist eine Multiport-Bridge
Port = Anschluss - An allen Ports darf nur ein LAN-Typ vorhanden sein
- Switches können in "Hubs" realisiert werden
- Es gibt auch Layer-3- und Layer-4-Switches
- Transparenz ab Ebene 3
An jedem Segment braucht nur ein Rechner angeschlossen zu sein; es können auch mehrere sein.
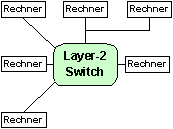
Bildbeschreibung "Layer-2-Switch": Realisiert sternförmige Verbindung von Rechnersegmenten.
Verknüpfungen zu Netzen: Hierarchie
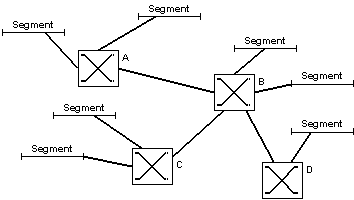
Bildbeschreibung "Verknüpfungen zu Netzen: Hierarchie": Vier Switches, die jeweils verschiedene Segmente bedienen, sind hierarchisch angeordnet. Switch A bildet die oberste hierarchische Ebene, Switch B ist ihm hierarchisch untergeordnet. Switch C und D unterstehen wiederum Switch B und bilden somit die unterste Ebene.
Verknüpfungen zu Netzen: Zyklen
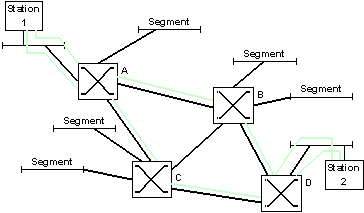
Bildbeschreibung "Verknüpfungen zu Netzen: Zyklen": Vier Switches, die jeweils verschiedene Segmente bedienen, sind zyklisch angeordnet. Switch A hat Verbindungen zu Switch B und C, diese sind ebenfalls miteinander verbunden und haben jeweils zu Switch D eine Verbindung. Nun werden zwei Stationen betrachtet. Station 1 hängt an Switch A, Station 2 an Switch D. Die Kommunikation dieser zwei Stationen erfolgt entweder über Switch B oder über Switch C. Beispiel: Station 1 senset Pakete an Station 2. Dazu werden die Pakete über Switch A, dann über Switch B, weiter über Switch D hin zu Station 2 transportiert. Ein anderer, ebenfalls möglicher Verbindungsweg würde von Switch A über Switch C hin zu Switch D sein.
Router
- Router vermitteln Wege innerhalb von Netzen
- Router koppeln auch unterschiedliche lokale Netze
- Es gibt lernende Routing-Verfahren
- Filterfunktionen (Erhöhung des Schutzes)
Router sind die Basis für Firewalls - Protokolltransparenz ab Ebene 4
OSI-Einbindung eines Router:
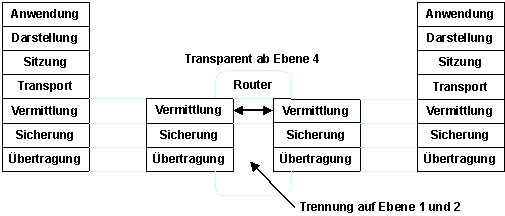
Bildbeschreibung "OSI-Einbindung eines Router": Router arbeiten auf OSI-Ebene 3, der Vermittlungsebene.
Gateway
Gateways sind Knoten innerhalb des Netzwerks, die Netze unterschiedlichen Typs miteinander verbinden.
Gateways setzen nicht nur Datenpakete um, sondern transformieren unterschiedliche Adressen (samt Formaten).
Anwendungsbeispiele:
- PC-Netze und Macintosh-Netze
- Novell-Netze und Internet/Intranet
- SNA (IBM) und Novell-Netz
OSI-Einbindung eines Gateway:
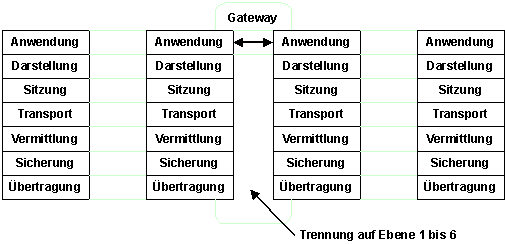
Bildbeschreibung "OSI-Einbindung eines Gateway": Arbeiten auf oberster OSI-Ebene, der Anwendungsebene.
Strukturierte Verkabelung
Logische vs. physikalische Topologie:
In Sterntopologie verlegte Kabel können auch für Ringe oder Busse benutzt werden, indem sie entsprechend am Sternpunkt verbunden werden.
Vorteile der Sterntopologie:
- Flexibilität
- Leichte Fehlersuche
Strukturierte Verkabelung:
Konzept zur Planung komplexer Verkabelungen mit folgenden Zielen:
- Verkabelung (möglichst) unabhängig von LAN-Typ (und damit von Übertragungstechnik): Investitionsschutz
- Systematische und zukunftsorientierte Abdeckung aller Gelände/Räume
- Herstellerunabhängige (standardisierte) Anschlusstechniken
- Hohe Flexibilität
z.B. nach Umzügen von Abteilungen, Neueinstellungen
Grundideen der strukturierten Verkabelung
Primärbereich:
- Geländeverkabelung zwischen Gebäuden eines Geländes
- Ziele: Blitzschutz, Ausfallsicherheit, Abhörsicherheit, Integration
Sekundärbereich:
- Verkabelung zwischen Etagen oder Gebäudeteilen
- Ziele: Netzwerkunabhängigkeit, schnelle Fehlersuche, Anpassbarkeit an Räumlichkeiten
- Beachtung der Biegeradien, Wandkanäle, Pritschen
Tertiärbereich:
- Verkabelung zwischen Räumen einer Etage
- Alle Räume mit Reserveanschlüsse
z.B. Deckenmontierten Flusskanal mit mehrfachen Stichkanälen - Aber auch: Beachtung gesetzlicher Bestimmungen
Endgeräteanschluss
